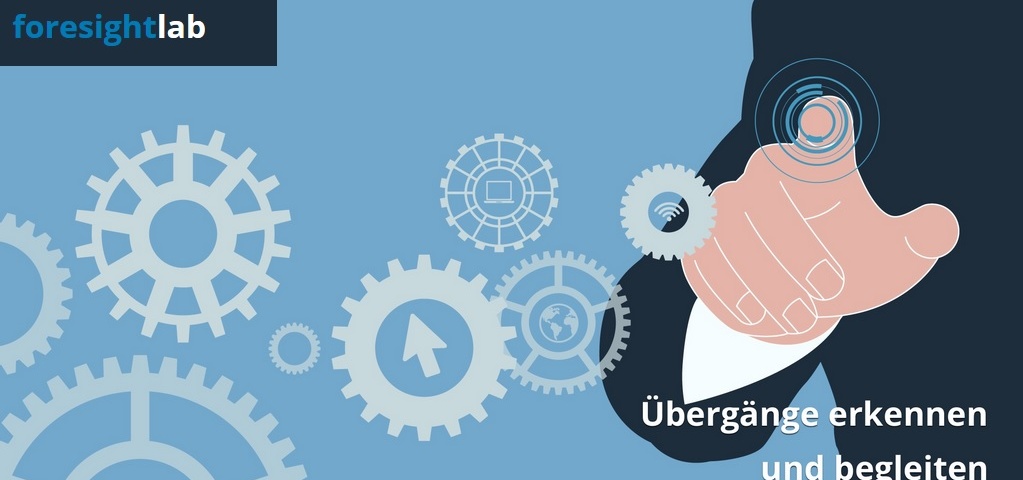
Wir haben Klaus Burmeister um einen Gastbeitrag gebeten. Hier ist er!
KLAUS BURMEISTER arbeitet seit Jahren als Foresight-Experte und Autor an Fragen zukünftiger gesellschaftlicher Entwicklung, hierzu hat er 2014 das foresightlab ins Leben gerufen.
Als ich gebeten wurde, einen kurzen Beitrag zu verfassen, habe ich spontan zugesagt. Das Thema „Wir machen die smarte Stadt“ sprach mich an. In meinem kurzen Beitrag möchte ich pointiert skizzieren, warum Städte gerade jetzt wichtig sind, was ich unter einer smarten Stadt verstehe und wie Städte uns helfen könnten, lebenswerte Zukünfte zu gestalten.
Wir leben in Zeiten des Umbruchs. Der Wandel wird zum Normalfall und Städte sind die Orte, wo die zunehmende Beschleunigung von Veränderungsprozessen, die wachsende Unübersichtlichkeit und die anhaltend hohe Innovationsdynamik konkret erfahrbar werden. Städte sind aber auch Heimat. Hier wird gearbeitet, konsumiert, geliebt, gelebt und hier ist man mobil. Städte sind Schmelztiegel für unterschiedliche Kulturen und Interessen. Permanent wird daraus Neues geboren, was dem Wandel wiederum neue Nahrung gibt. Städte sind, so könnte man sagen, die Seismographen und Laboratorien des Wandels.
Wichtig ist es, sie zu verstehen. Wenn man sich der Stadt analytisch nähert, dabei auf einzelne Funktionen fokussiert, verschwimmen schnell ihre Konturen, sie ufert aus und sie entzieht sich einem einfachen Zugriff. Verbleibt man in einer Helikopter-Perspektive, zeigt sie sich wie ein schwer dechiffrierbarer, verschachtelter Schaltplan. Wollen wir die Stadt begreifen, brauchen wir beide Zugänge, das Wissen über die Funktionsweise der Teilsysteme und ein Verständnis für die Stadt als System.
Was ist nun eine smarte Stadt? Eine smarte Stadt steht für mich nicht synonym für „Smart City“. „Smart City“ ist oft eher ein chic verpackter Container, gefüllt mit den alten Problemen und technisch getriebenen Lösungsversprechen großer IT-Konzerne wie Bosch oder Cisco. Ihre mächtigen Werkzeuge basieren auf Big Data-Analysen vernetzter Smart Devices im Internet of Things. In Echtzeit, so das Versprechen, lassen sich Prozesse kontrollieren und steuern, vom unfall- und staufreien Autoverkehr über nachhaltige Energie- und Logistiksysteme bis hin zur digitalen Verwaltung und Bürgerpartizipation. Der aktuelle „eGovernment MONITOR 2017“ der Initiative D21 zeichnet dagegen ein eher ernüchterndes Bild. Gelungene Beispiele für umfassende Smart City-Lösungen sind mir bislang nicht bekannt. Dies ist kein Abgesang auf die Smart City, hierzu sind die großen Städte bereits zu sehr involviert (s.a. Smart City Charta), vielmehr eine bescheidene Intervention für ein Rethinking bestehender Smart City-Ansätze.
Eine smarte Stadt verzichtet nicht auf IT-basierte Lösungen. Sie verfolgt im Gegensatz einen umfassenderen Innovationsansatz, der alle Beteiligte frühzeitig einbezieht, der zwischen mach- und wünschbaren Zielen abwägt und gleichermaßen soziale und organisatorische Aspekte einbezieht. Die Konzeption der strategischen Forschungs- und Innovationsagenda der Zukunftsstadt des Bundesministeriums für Forschung- und Bildung, liefert eine fast ideale Blaupause für smarte Städte. Allerdings konnte der hohe Anspruch in der Praxis des laufenden Wettbewerbs „Zukunftsstadt“ nicht eingehalten werden. Smarte Städte sind im besten Falle Reallabore. Sie reagieren und interagieren permanent mit ihrer Umwelt. Sie leben vom gemeinsamen Handeln wechselnder städtischer Akteure mit oft sehr unterschiedlichen Interessen. Smarte Städte sind deshalb klug. weil sie ihre Vielfalt nutzen und sich als Ermöglicher verstehen.
Aber wer bewegt die smarte Stadt? Es muss dabei nicht immer die Verwaltung oder die Politik sein. Damit entlasse ich sie nicht aus der Verantwortung. Sie sollten allerdings definieren, welche Rolle sie wann spielen wollen, die des Verwalters, des Moderators, Betreibers, Nutzers, Impulsgebers oder Gestalters. Eine zentrale Aufgabe obliegt ihnen auf jeden Fall, sie müssen das Gemeinwohl im Auge behalten, um eine mögliche Dominanz wirtschaftlicher Interessen auszutarieren und eine breite Beteiligung der Zivilgesellschaft zu garantieren. Smarte Städte gehen neuartige und wechselnde Innovationsallianzen ein. Sie leben von Engagement städtischer Akteure, die auch mal selber „Geld in die Hand nehmen“, ob über Crowdfunding, mit Blockchain oder durch ein privates Investment. Zukunft ohne Risiken ist eine Ungleichung, sie wird es nicht geben.
Wir leben in einer Zeit in der wir „mehr herstellen als wir uns vorstellen können.“ Dieser Satz von Günter Anders aus dem Jahre 1956 bringt es treffend auf den Punkt. Die Aussage entfaltet vielleicht erst beim zweiten Lesen ihre Bedeutung. Wir müssen fantasievoller und radikaler Denken. Der gesamte Kontext von Leben, Arbeiten, Produzieren und Konsumieren kann und muss neu gedacht werden. An dieser Stelle kann ich nur exemplarisch auf zwei disruptive Potenziale städtischer Entwicklung hinweisen (Ich spare das Thema Künstliche Intelligenz bewusst aus, weil es einer ausführlichen Analyse und Einordnung bedarf):
- Die Potentiale plattformgestützter autonomer Verkehre und intermodale Mobilitätsysteme. Hierbei es geht um nicht weniger als um die Rückeroberung des öffentlichen Raumes. Was das in absehbarer Zeit für die Städte heißen kann, ist im „Blueprint for Autonomous Urbanism“ der NACTO, einer NGO amerikanischer Städte nachzulesen.
- Das Thema urbane Produktion, dass durch Industrie 4.0 zurück auf die Agenda der Städte kommt. Verbunden mit Ansätzen von Microfabriken, wie sie Local Motors (also Airbus) plant oder der Speedfactory von Adidas in Ansbach erfährt die Zukunft der Arbeit auch neuartige regionale Potentiale. Was wäre, wenn man diese neuen Möglichkeiten verbinden würde mit der Startup-Szene, Makern? Das Verbundvorhaben COWERK denkt u.a. in eine Richtung, die Industrie 4.0 in Sinne einer Green Economy erweitern könnte.
Wir müssen und vor allem wir können Stadt neu denken. Um dies tun zu können, benötigen wir neben der Entfaltung von Ideen, Visionen und Kreativität vielfältige neue Formen und Erprobungsräume für experimentelle Politik. Hierzu haben sich auch unlängst die Spitzenverbände von Wirtschaft und Wissenschaft bekannt .
Benötigt werden handelnde Akteure, die bereit sind Innovationshürden zu überwinden und Verwaltungen und Politik, die den Weg ebenen für Pilotprojekte und Freiräume auf Zeit eröffnen. Open Innovation, Co-creation und Kooperation mit unterschiedlichen Akteuren sind essentielle Bestandteile systemischer Innovationen, die gilt es in allen zentralen Handlungsfeldern, von Mobilität und Infrastruktur über die Energie und Umwelt bis zu Bildung und Arbeit anzugehen. Siehe hierzu auch die D2030-Szenarien „Neue Horizonte.
Es mag zum Schluss fast etwas altmodisch klingen, aber Städte sind immer die zentralen Erfahrungs- und Erprobungsorte für eine lebendige Demokratie gewesen. Wir brauchen sie auch weiterhin als smarte Partner in unruhigen Zeiten für die Mitgestaltung lebenswerter Zukünfte.